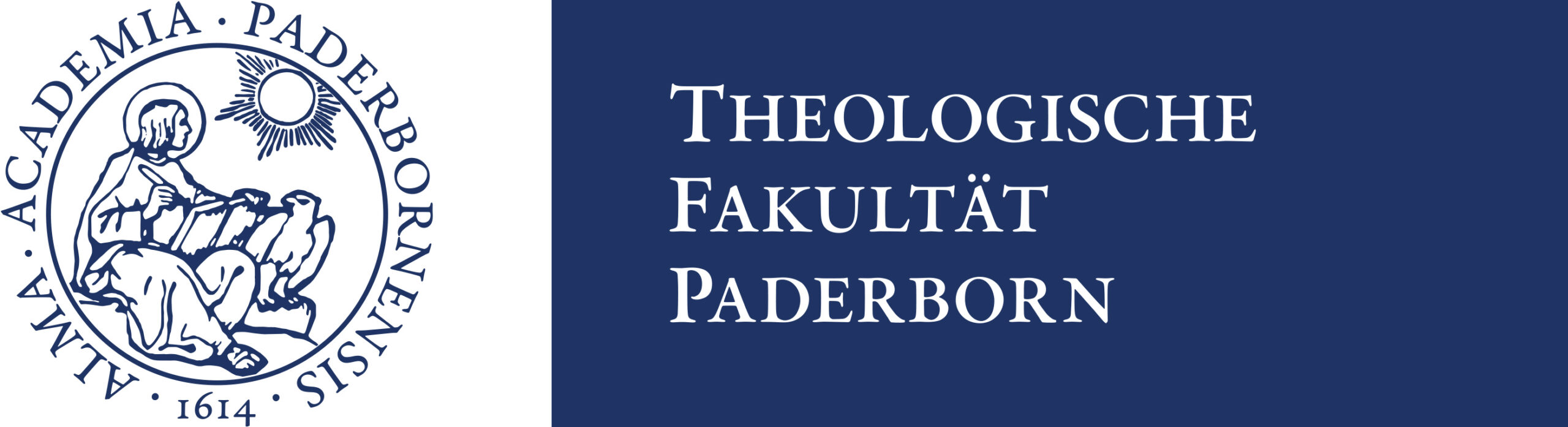Vor zweihundert Jahren entstand das Bistum Paderborn nach seiner Gründung im Jahr 799 quasi ein zweites Mal: Mit der Päpstlichen Bulle „De salute animarum“ – Über das Heil der Seelen – wurde am 16. Juli 1821 das Paderborner Bistum neu umschrieben und dadurch zum damals zweitgrößten Bistum in Preußen. Papst Pius VII. unterschrieb die Vereinbarung zwischen dem Heiligen Stuhl und Preußen über die Neuordnung der Bistümer und veränderte damit den Zuschnitt des Bistums Paderborn grundlegend und vergrößerte seine Fläche immens. Zum Jubiläum der Päpstlichen Bulle spricht Professor Dr. Hermann-Josef Schmalor (70) über ihre historische Bedeutung. Der ehemalige Direktor der Erzbischöflichen Akademischen Bibliothek lehrt noch heute das Fach Bistumsgeschichte an der Theologischen Fakultät Paderborn.
Herr Professor Schmalor, wie lassen sich die wesentlichen Inhalte der Päpstlichen Bulle kurz zusammenfassen?
Hauptinhalt der Bulle ist die Neuumschreibung der Bistumsgrenzen in den Territorien des Königreichs Preußen. Betroffen waren neben Paderborn auch beispielsweise das Erzbistum Köln und die Bistümer Breslau, Münster und Trier.
Weiterhin schließen die Bestimmungen der Päpstlichen Bulle auch die Neuerrichtung der Domkapitel mit sehr konkreten Regelungen über die Dotation der Bischöfe und Domherren sowie der Bischofswahlen ein. Es geht darin auch um die Errichtung und Unterhaltung bestimmter diözesaner Institutionen, zum Beispiel das Priesterseminar, sowie die Bestätigung beziehungsweise Einrichtung des Amtes der Weihbischöfe.
Wie kam es zur Vereinbarung zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Staat Preußen?
Im Frieden von Lunéville war 1801 den Staaten, die nach der französischen Besetzung der linken Rheinseite von Gebietsverlusten betroffen waren, eine Entschädigung zugesagt worden. Diese sollte vorwiegend durch eine Säkularisierung der geistlichen Staaten erfolgen. Die Durchführung der Eingliederung der neuen Gebiete in die zu entschädigenden Staaten wurde im sogenannten Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803 rechtlich fixiert. Das Fürstbistum Paderborn wurde dabei aufgehoben und der preußischen Monarchie als „Erbfürstentum“ einverleibt.
Im Jahre 1807 wechselte die staatliche Zuständigkeit erneut, als nach den Siegen Napoleons und dem Frieden von Tilsit 1807 das Königreich Westphalen unter König Jérôme Bonaparte geschaffen wurde. Dieses fand jedoch bereits nach der französischen Niederlage in der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 sein Ende.
1815 wurde beim Wiener Kongress das nachnapoleonische Europa politisch neu geordnet. Das Territorium des ehemaligen Fürstbistums Paderborn wurde nun in die neue preußische Provinz Westfalen eingegliedert. Nach der Konsolidierung der staatlichen Verhältnisse strebte auch die Kirche eine Neuordnung der Beziehungen zu den Staaten an. Nach intensiven Verhandlungen zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Königreich Preußen wurden die Ergebnisse dieser Verhandlungen päpstlicherseits in der Bulle „De salute animarum“ festgehalten, preußischerseits im Gesetzblatt für das Königreich Preußen veröffentlicht. Dadurch wurde der Text der Päpstlichen Bulle sowohl kirchliches wie auch staatliches Gesetz.
Was sollte mit der Neugliederung der Bistümer in Deutschland erreicht werden?
Dem Königreich Preußen lag daran, dass die kirchlichen Grenzen (Bistümer) mit den staatlichen Grenzen übereinstimmten, um ohne Einfluss auswärtiger Staaten die kirchlichen Angelegenheiten bilateral regeln zu können. Die Kirche strebte ebenfalls eine Deckungsgleichheit von staatlichen und kirchlichen Grenzen an, um auf einer verlässlichen Basis mit den staatlichen Stellen kooperieren zu können. Bedeutsam war die verlässliche Basis im Bereich der finanziellen, im Reichsdeputationshauptschluss 1803 festgelegten Staatsleistungen für die Kirche.
Wie ist es zu erklären, dass 1821 ausgerechnet das ostwestfälische Bistum erhalten blieb und nicht wie andere Bistümer aufgelöst wurde?
Für die Auflösung und das Weiterbestehen von Bistümern nach der Säkularisation gab es unter anderem auch machtpolitische Gründe wie etwa bei der Zerschlagung des ehemals sehr bedeutenden Bistums Konstanz in Süddeutschland oder bei der „Degradierung“ der ehemaligen Erzbistümer Mainz und Trier zu einfachen Bistümern. Für das Bistum Paderborn innerhalb des preußischen Staates war sicher seine Lage im östlichen Bereich der Territorien mit einer „ordentlichen“ Kirchenverfassung bedeutsam. Östlich davon gab es neben dem Bistum Hildesheim, das zum Königreich Hannover zu zählen ist, also nicht preußisch war, lediglich das riesige Diasporagebiet, das als „Apostolisches Vikariat des Nordens“ von einem der Diözesan- oder Weihbischöfe – meist aus Paderborn oder Hildesheim – verwaltet wurde. Es bot sich daher geradezu an, das kleine Bistum Paderborn nach Osten auszuweiten und dann im Westen mit Teilen der Bistümer Köln, Osnabrück und Mainz „abzurunden“. Das neue, große Bistum Paderborn wurde dadurch natürlich auch zu einem ernst zu nehmenden Gesprächspartner des Staates.
Ein großer Vorteil für das Bistum Paderborn war ebenfalls, dass es mit Franz Egon von Fürstenberg noch einen „regierenden“ Bischof gab, der die geistliche Gewalt noch voll ausüben, das heißt auch kompetent für die kirchlichen Angelegenheiten sprechen und entscheiden konnte. Dagegen herrschte etwa in Köln und Münster seit 1801 eine langjährige Sedisvakanz.
Durch die Bulle wurde Paderborn von einem kleinen zum zweitgrößten Bistum in Preußen. Welche Herausforderungen brachte das mit sich?
Für das Bistum Paderborn bedeutete die enorme territoriale Vergrößerung eine extreme Herausforderung, sowohl für die kirchliche Verwaltung dieses Gebietes wie auch für die Seelsorge. Zu bedenken ist auch, dass nicht nur gut strukturierte katholische Gebiete hinzukamen, beispielsweise das Kölnische Westfalen oder das Eichsfeld, sondern auch große Diasporagebiete im Osten, zum Beispiel die Gebiete um Magdeburg und Halberstadt, die zu dem nur sehr wenig durchstrukturierten Apostolischen Vikariat des Nordens gehört hatten.
Wie ist man den Herausforderungen begegnet?
Die Durchführungsbestimmungen der Bulle „De salute animarum“ hatten dafür gesorgt, dass man nicht alles auf einmal neu gestalten musste. Man ging langsam, Schritt für Schritt, im Westen anders als im Osten, bei der Bewältigung dieser Herausforderungen vor. Während etwa der Westen im Jahre 1832 wegen der besseren Kommunikation und der intensiveren Seelsorgemöglichkeiten neu strukturiert wurde im Hinblick auf die Dekanatseinteilung, entstanden im Osten relativ selbständige Verwaltungseinheiten, die Kommissariate, die auch mit der wegen der Weitläufigkeit sehr schwierigen Seelsorge in diesen Gebieten betraut wurden, beispielsweise mit der Gründung von Missionspfarreien.
Paderborn wurde durch die Päpstliche Bulle zu einem Großbistum, die Stadt in Ostwestfalen zu einem kirchlichen Oberzentrum. Wie wurde das bewertet?
Durch den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 wurde das Fürstbistum Paderborn dem Königreich Preußen zugesprochen. Zu dieser Zeit war die Stadt Paderborn eine agrarisch und kleinbürgerlich geprägte Stadt mit rund 4.700 Einwohnern. Der Umbruch wurde von den Bürgern zumeist sehr skeptisch begleitet. In der napoleonischen Zeit (König Jérȏme Bonaparte, Napoleons Bruder) verlor Paderborn die Stellung als Hauptstadt und sank in der 1815 gebildeten Preußischen Provinz Westfalen auf das Niveau einer Kreisstadt hinab.
Die Stadt Paderborn war nun weder Provinzialhauptstadt (Münster) noch Sitz des Regierungsbezirks (Minden). In dieser Situation war die Aufwertung von Paderborn als Sitz eines der größten Bistümer in Preußen doch sehr imagefördernd für die Stadt und wirtschaftlich ansprechend für deren Bewohner.
Wie waren die Reaktionen in den betroffenen Gebieten?
In den kirchlich sehr unterschiedlich strukturierten neuen Gebieten des Bistums Paderborn waren natürlich auch die Reaktionen auf die Veränderungen recht verschieden. Während man im Westen, besonders im Sauerland, wohl eher noch an der alten Zugehörigkeit zum Erzbistum Köln hing und bis heute diese historische Bindung noch zu spüren ist (1000 Jahre Köln – 200 Jahre Paderborn !), gab es in den weiten östlichen Diasporagebieten derartige geschichtlich bedingte Bezüge zur den alten Verhältnissen wohl eher nicht. Vielleicht wurde dort die neue Zuständigkeit von Paderborn gegenüber der ehemaligen Zugehörigkeit zum mehr konturlosen Apostolischen Vikariat des Nordens als eher positiv empfunden.
Als Paderborner Theologe und Kirchenhistoriker: Wie bewerten Sie die Veränderungen?
Am Ende des 18. Jahrhunderts hatte sich das öffentliche Klima unter dem Eindruck des Aufklärungsdenkens zunehmend zuungunsten der Einrichtungen der katholischen Kirche entwickelt. Die Kirche hatte durch die Säkularisation nicht nur viele materielle Kirchengüter, sondern auch ihre bisherigen Macht- und Herrschaftsbefugnisse verloren.
Das physische Überleben der kirchlichen Institutionen war nur durch eine völlige Neubestimmung des Verhältnisses von Kirche und Staat durch Konkordate und Zirkumskriptionsbullen sicher zu stellen. Nach einer tiefen mentalen Depression, in der sich die Kirche und das Kirchenvolk nach all den Demütigungen in den ersten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts befand, kam es schon bald zu Anzeichen neuen Selbstbewusstseins und innerer Stärke, nachdem man den Verlust der politischen Macht akzeptiert und den Bedeutungsschwund des Adels, dessen Dominanz in den kirchlichen Strukturen verloren gegangen war, positiv verarbeitet hatte. Das bedeutet in meinen Augen: Ohne die tiefgreifenden Veränderungen durch die Neustrukturierung der Diözesen in der Bulle „De salute animarum“ wäre vermutlich auch der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehende Aufschwung des kirchlichen Lebens in dieser Form nicht möglich gewesen.
Das Bistum Paderborn hat sich weiterentwickelt, wurde 1930 Erzbistum, hat 1956 an das neue Bistum Essen und 1994 an das neue Bistum Magdeburg Gebiete abgegeben, hat also einen neuen Flächenwandel vollzogen. Wie bewerten Sie diesen?
Einschneidend war in der weiteren Entwicklung zweifellos die 1930 erfolgte Errichtung der Mitteldeutschen Kirchenprovinz mit Paderborn als Metropolitansitz. Das bedeutete konkret im Jahr 1930, dass Paderborn zum Erzbistum wurde mit den Bistümern Fulda und Hildesheim als Suffraganbistümern. Die Bedeutung Paderborns innerhalb der Katholischen Kirche in Deutschland hatte damit ein neues Niveau erreicht.
Über die Gründung des Bistums Essen kann man heute auch anderer Meinung sein als 1957. Aus heutiger Sicht wäre wohl die Bildung eines „Ruhrbistum“ nicht unbedingt erforderlich gewesen.
Die Erhebung Magdeburgs zum Bistum war 1994 eine Konsequenz der deutschen Wiedervereinigung. Aus dem ehemaligen Kommissariat war bereits in den 1970er Jahren eine Apostolische Administratur geworden, also ein direkt dem Papst unterstelltes, relativ selbstständiges Gebilde. Für die Zukunft stellt sich die Frage, ob dieses Diasporabistum mit einer sehr geringen Katholikenzahl, es sind knapp 80.000 Katholiken, finanziell auf Dauer existieren kann.
Im Jahr 1994 wurde auch die Mitteldeutsche Kirchenprovinz neu umschrieben: Das Bistum Hildesheim kam zur neu gebildeten Kirchenprovinz Hamburg. Neben dem Bistum Fulda gehören von nun an auch die Bistümer Magdeburg und Erfurt zur Kirchenprovinz des Erzbistums Paderborn.
Abschließend eine persönliche Frage, Herr Professor Schmalor: Sie wurden vor 70 Jahren in Sundern-Hagen, also mitten im Sauerland geboren. Das Sauerland gehörte ursprünglich zum Bistum Köln, kam 1821 zum Bistum Paderborn. Was bedeutet das heute für Sie als Sauerländer?
Ich muss gestehen, dass ich hin und wieder auch gerne mal in die Kölner Vergangenheit zurückblicke, zumal ja auch mein Vorname „Hermann-Josef“ nach Köln weist. Allerdings fühle ich mich auch im diözesanen Paderborner Kernland wohl und singe mittlerweile auch ganz gerne die Libori-Lieder, früher aus dem „Sursum corda!“, heute aus dem Paderborner Anhang des Gotteslobes.
Text und Fotos: Thomas Throenle, Erzbistum Paderborn