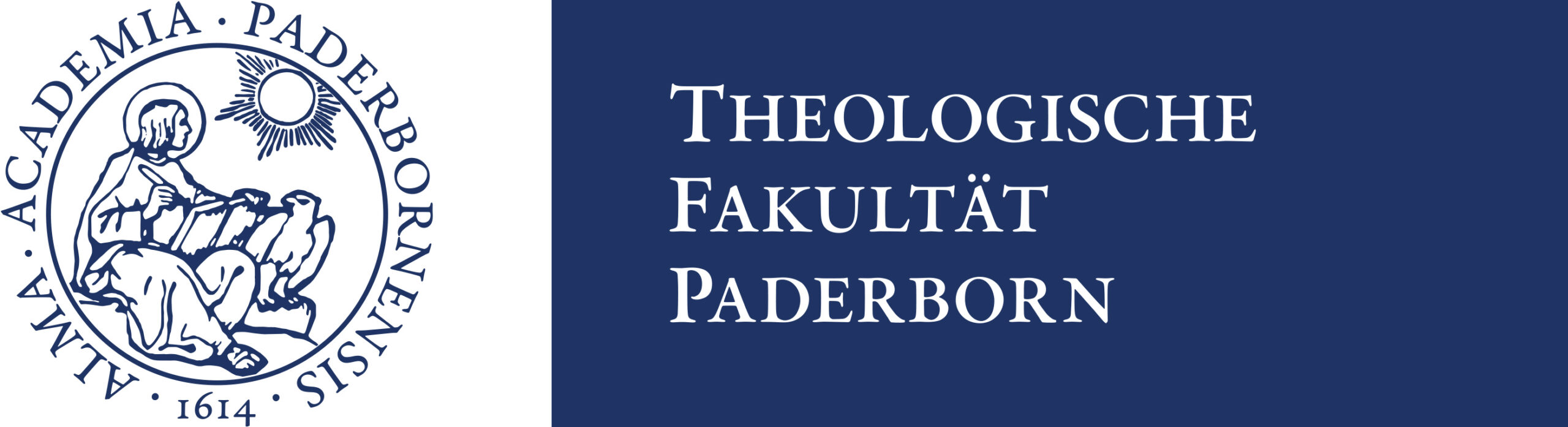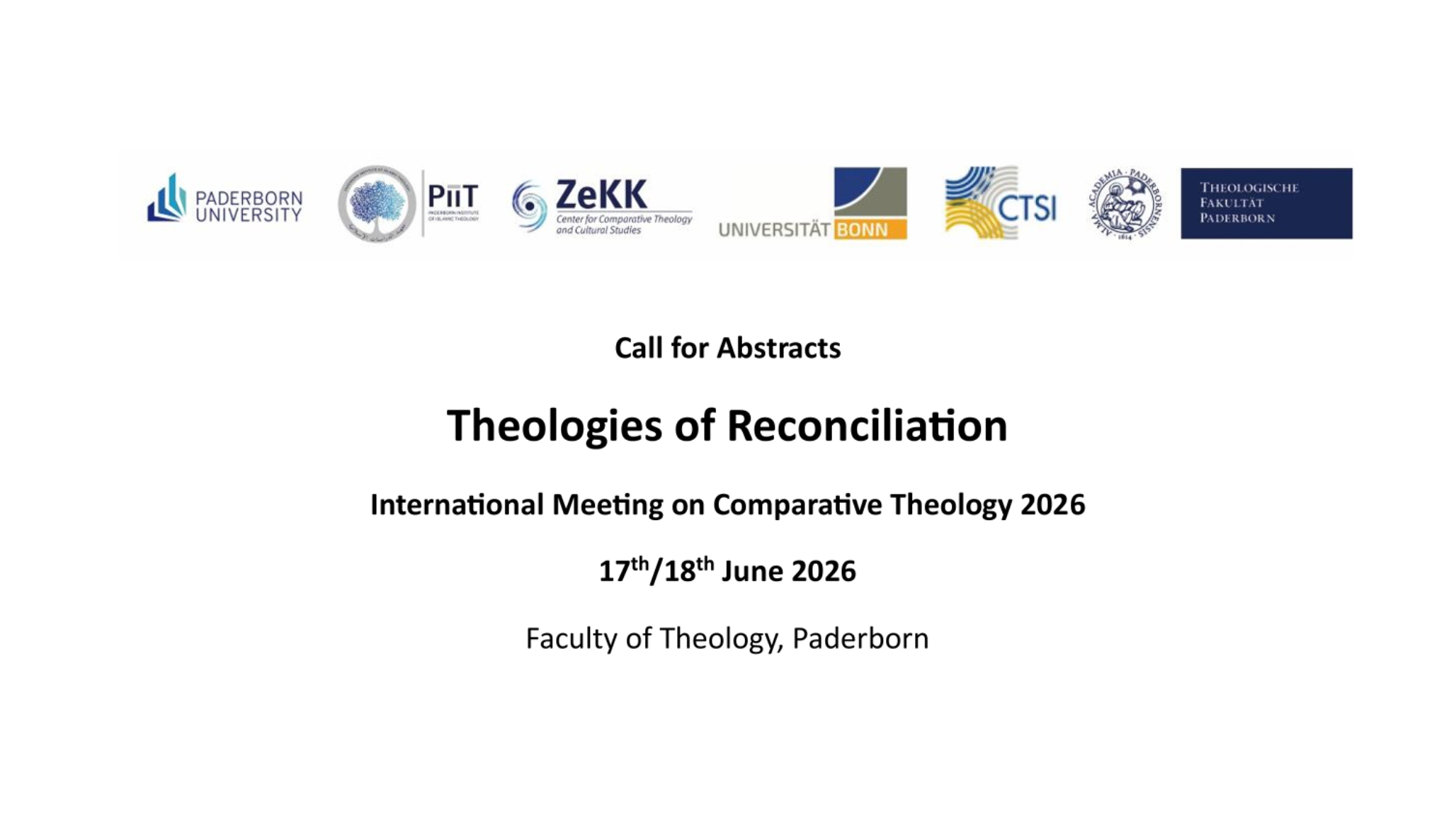Staubig, trocken und düster: so stellen sich viele das Forschen in alten Archiven und Bibliotheken vor. Der Kirchenhistoriker Dr. Frank Sobiech von der Theologischen Fakultät Paderborn kennt das Klischee. Doch für ihn bedeutet die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Geschichte das genaue Gegenteil.
Natürlich kann das Arbeiten an geschichtlichen Fragestellungen manchmal mühevoll und nur wenig erquicklich sein. Das weiß auch Dr. Frank Sobiech. Aber für den 47-jährigen Kirchenhistoriker aus Paderborn überwiegen am Ende in den allermeisten Fällen Freude und Begeisterung, wenn neue historische Erkenntnisse die Vergangenheit lebendig, bunt und vielfältig werden lassen. „Erst kommt die Mühe, dann die Freude“, nennt das der gebürtige Paderborner.
Das Spannende ist aus Sicht des promovierten und habilitierten Theologen, der zudem weitere Studienabschlüsse in Jura, Geschichte und Latein vorweisen kann, Vergangenes chronologisch einzuteilen und dabei zu lernen, „mit Geschichte, der Zeit und ihrem Lauf“ umzugehen. Dann etwa hätten Forschungsergebnisse meist auch Rückwirkung auf das eigene Leben. Der Privatdozent an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Würzburg und Wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kirchengeschichte und Patrologie der Theologischen Fakultät Paderborn ist überzeugt: „Wer sich mit Geschichte beschäftigt, lernt auch sein eigenes Leben zu betrachten und sich in seiner eigenen Lebensgeschichte zurechtzufinden“.
Dass das Herz von Dr. Sobiech für die Kirchen-Geschichte schlägt, liegt nicht zuletzt an der ganz besonderen Komponente, die zu der rein profanen Geschichtswissenschaft hinzukommt: „die Heils-Geschichte“. Beispielsweise wenn der Einzelne sich fragt, wann er getauft und gefirmt wurde, in welchem chronologischen Zusammenhang das stand und was da genau geschah. Schließlich füge sich „die eigene Lebensgeschichte ja in den Gesamtfluss der Christentums- und Kirchengeschichte“ ein.
Um vergangene Zeiträume überhaupt erst erkunden zu können, die einem ansonsten verschlossen bleiben, sei das Entscheidendste bei der historischen Forschung, die richtigen Fragen zu stellen. Das könne man besonders gut von Kindern lernen, meint Dr. Sobiech, für den es „ohne Fragestellung keine Geschichtsschreibung“ gibt. Außerdem sei für die Kirchengeschichte als Wissenschaft von Bedeutung, „nicht mit fertigen Konzepten an die Vergangenheit heranzutreten, sondern sich überraschen zu lassen“. Neugierde sei ganz wichtig, wenn man wissen wolle, wie es früheren Christen ergangenen sei.
Hinzu komme ein ganz bestimmter Maßstab, an dem sich die Vergangenheit des Christentums und der Kirche messen lassen müsse. Die Kirchengeschichte habe nämlich danach zu fragen, „ob das Verhalten der Christen in der Vergangenheit dem Evangelium gemäß war“. Dabei sei zu beachten, „dass sich das kirchengeschichtliche Instrumentarium mit der Zeit auch ändern kann, ähnlich wie Moden, die vorübergehen“. Darum müsse Geschichte auch immer wieder neu geschrieben werden. „Man kann die Geschichte nicht ein für alle Mal festzurren. Als Kirchenhistoriker muss man offen sein für das, was einem in den Quellen begegnet, auch wenn die subjektive Sicht nie ganz zu vermeiden ist.“
Aktuell liegen drei größere Projekte auf dem Schreibtisch von Dr. Sobiech. Zum einen möchte er eine „kleine Geschichte der Theologischen Fakultät Paderborn“ veröffentlichen. Auf die Idee kam der erfahrene Kirchenhistoriker, dessen Spezialgebiet die Frühe Neuzeit ist, im Rahmen früherer Quellenforschungen. Zum anderen arbeitet er an der Transkription und Edition eines „Tagesbuches der Spirituale des römischen Collegium Germanicum et Hungaricum“ aus dem 16. Jahrhundert. Bei dem dritten Projekt geht es um die frühere Entwicklung des Pilgerwesens rund um die franziskanische Kustodie des Heiligen Landes. Neben den Lehrveranstaltungen kommt dann natürlich auch noch die Arbeit am Lehrstuhl für Kirchengeschichte und Patrologie hinzu. Hier geht es gerade schwerpunktmäßig um die Erstellung einer Chronologie und einer örtlichen Reihenfolge der Sermones ad populum – zu Deutsch: „Predigten an das Volk“ – des Kirchenvaters Augustinus (354–430).
Für Dr. Sobiech ist die Kirchengeschichte keineswegs nur für Fachleute interessant, sondern hat auch allgemein historisch Interessierten viel zu bieten: zum Beispiel ganz besondere Persönlichkeiten, „Leute wie Friedrich Spee, die sich ganz auf das Evangelium eingelassen und mit der Gnade Gottes Bedeutendes geleistet haben“. Das Standbild von ihm am Kamp in der Paderborner Innenstadt verdeutliche die öffentliche Bedeutung. Die Kirchengeschichte erinnere an solche Personen, „die in ihrem Leben nicht nur rein innerweltliche Projekte verfolgt haben, sondern aufgrund des Glaubens ihren Blick auch darüber hinaus auf das Jenseitige richteten“.
Es sind diese außergewöhnlichen Lebenswege vieler Christinnen und Christen, die aus Sicht des leidenschaftlichen Theologen so anziehend wirken können, sogar auf diejenigen, die mit Glauben und Religion zunächst einmal gar nicht viel zu tun haben. Darum möchte Dr. Sobiech weiterhin das Ziel verfolgen, Kenntnisse der Kirchengeschichte über Expertenkreise hinaus bekanntzumachen und kirchengeschichtliches Wissen in der Breite anzubieten, auch damit innerkirchlich wieder größere Zusammenhänge neu erkannt werden können.
Seine berufliche Zukunft sieht Dr. Sobiech im Bereich der Wissenschaft. Mit Blick auf das Leben der einzelnen Christen möchte er weiterhin für die Kirche als Historiker arbeiten und wirken. Zurzeit befindet er sich für mehrere Tage in Rom zu einem Forschungsaufenthalt. Neben Archivbesuchen steht diesmal im Rahmen einer internationalen Tagung auch ein Vortrag über Niels Stensen (1638–1686), den 1988 seliggesprochenen Universalgelehrten und unter dem damaligen Paderborner Fürstbischof Ferdinand von Fürstenberg in Münster wirkenden Weihbischof, auf dem Programm.