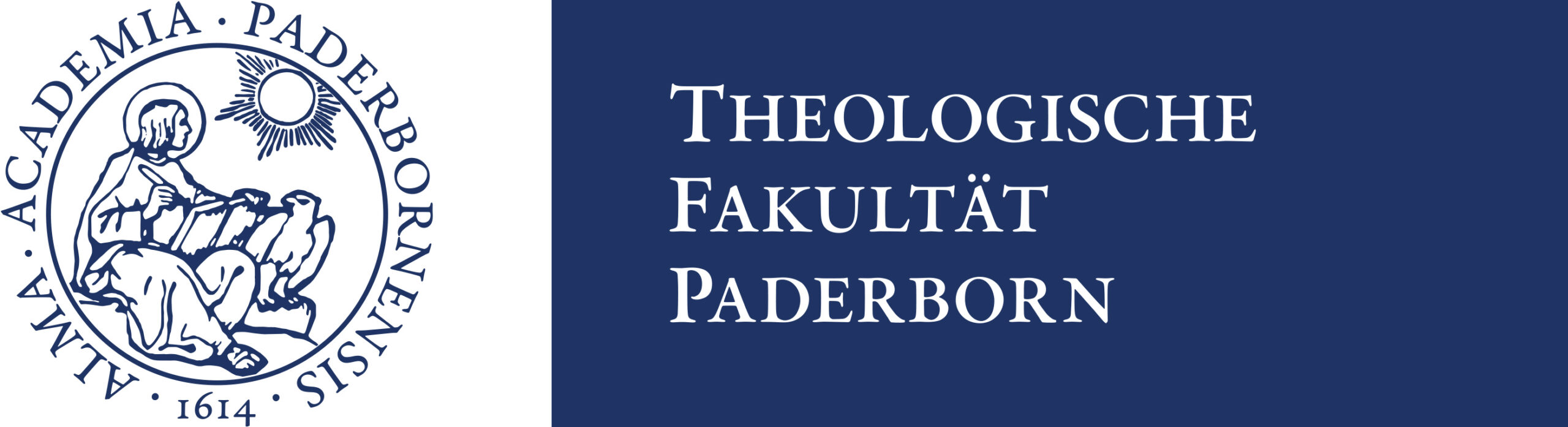Aaron Langenfeld: Wie würden Sie Hoffnung aus christlicher Sicht definieren?
Massimo Faggioli: Hoffnung und Christentum sind eng miteinander verbunden – aber die christliche Hoffnung ist letztlich die Hoffnung auf die Auferstehung. Ein blinder Optimismus innerhalb des Christentums läuft auf eine unbewusste Säkularisierung der christlichen Hoffnung hinaus, indem er die tragische Dimension, die dem Kreuz Jesu Christi innewohnt, ausblendet. Ohne das Kreuz gibt es keine christliche Hoffnung. Auf der anderen Seite haben Christen gelernt, jenen falschen Propheten zu misstrauen, die die Notwendigkeit von Gerechtigkeit in diesem Leben und auf dieser Erde ablehnen – eine falsche Prophezeiung, die als Reaktion eine Reihe von Utopien hervorgebracht hat, die das Christentum als grundlegende Opposition gegen die Entwicklung und Verbesserung des Menschen betrachten.
Aaron Langenfeld: Was unterscheidet Hoffnung von Utopie?
Massimo Faggioli: Hoffnung wird durch Christus Jesus verkörpert: Sie ist nicht unsere Haltung, sondern eine Person vor und neben uns, zu der wir eine echte persönliche Beziehung haben können – bis hin zur Angleichung an diese Person. Die christliche Hoffnung ist objektiv der neue Horizont, in den wir eingebunden sind, der theologische Ort, an dem wir Erlösung finden können, wobei die Hoffnung selbst genau diese Person ist, die keine Enttäuschungen bereitet und keine Illusionen schmuggelt. Zwischen Utopie und Dystopie gibt es eine feine Grenze.
Aaron Langenfeld: Welche Herausforderungen für ein christliches Verständnis von Hoffnung sehen Sie heute?
Massimo Faggioli: Heute sind Utopien weniger offen politisch als in den beiden vorangegangenen Jahrhunderten. Gegenwärtig sind sie technologisch, aber mit beängstigenden politischen Konnotationen. Sie haben auch parareligiöse Züge, wenn man die Projekte verfolgt, die derzeit aus dem Silicon Valley kommen – von KI über Transhumanismus bis hin zur Eroberung des Mars. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass es sich heute eher um privatisierte Utopien handelt, die nur einer bestimmten sozialen Schicht zugänglich sind. In einigen Fällen handelt es sich um eine Utopie, die einen anderen Topos, einen anderen physischen Ort gefunden hat oder schafft – das kann das Leben in einer der „Gated Communities” sein, oder das Angebot der Staatsbürgerschaft durch Investitionen für Ausländer in einigen Ländern, oder Silicon-Valley-Milliardäre, die in schwimmende Städte in internationalen Gewässern investieren, oder sogar das Leben auf dem Planeten Mars. Diese ultra-elitären Projekte offenbaren bei ihren „Anhängern” eine Ambivalenz gegenüber unserer Zukunft: Hoffnung für wenige und Verzweiflung für viele. Eine Fluchtmöglichkeit für wenige zu schaffen, ist eine Falle für die vielen. Ungeachtet ihrer Verteidigung eines vagen „kulturellen Christentums” sind diese Projekte zutiefst antichristlich.
Aaron Langenfeld: In Ihrem Vortrag haben Sie die Relevanz von Gaudium et spes für unser Verständnis von Hoffnung reflektiert – zu welchem Schluss kommen Sie hinsichtlich der Relevanz der Pastoralkonstitution heute?
Massimo Faggioli: Das Zweite Vatikanische Konzil formuliert eine Theologie der christlichen Hoffnung. Die Konstitution Gaudium et Spes enthält eine großartige Erzählung, die nicht mit der liberalen Idee des Fortschritts übereinstimmt. Die Erzählung handelt von einer Kirche als pilgerndem Volk, das als Teil der einen Menschheitsfamilie durch die Geschichte wandert. Diese Erzählung einer allumfassenden Menschheitsfamilie ist Teil einer Heilsgeschichte, aber dieses Narrativ droht verloren zu gehen. Das ist heute wichtig, da die Sprache der Information auf Kosten der Sprache der Erzählung allgegenwärtig geworden ist. Ohne eine gemeinsame Sprache gibt es keine Hoffnung. Die Sprache, die Erzählung der Hoffnung, kann ein Gefühl der Hoffnung vermitteln. Reine Informationen aus Daten können das nicht.