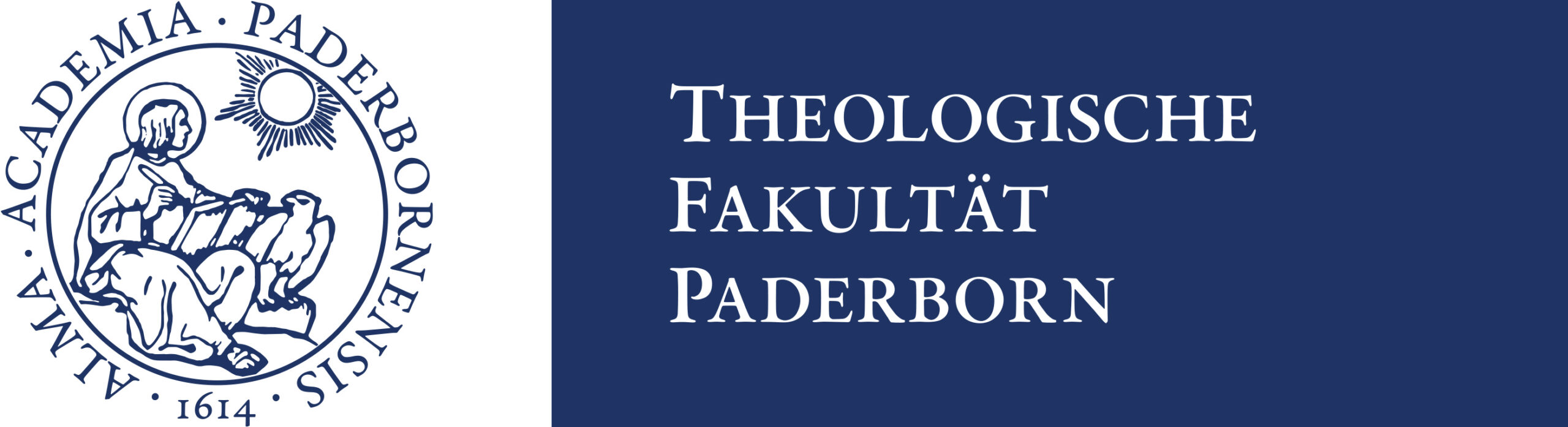Mit der Veröffentlichung des Bandes in der Reihe „Elements in Religion and Monotheism“ bei Cambridge University Press knüpft er an den breiten Forschungsdiskurs im angelsächsischen Raum an. Heike Probst, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sprach mit ihm über die Entstehung und den Inhalt des Buches und mögliche Anschlussprojekte.
Heike Probst: Ihr neues Buch „Monotheism and Relativism“ ist kürzlich bei Cambridge University Press erschienen. Was hat Sie zu dieser englischsprachigen Publikation bewegt?
Bernd Irlenborn: Ich forsche seit ungefähr zehn Jahren zum Thema „Relativismus“. In den letzten Jahren hat es mich einfach interessiert, diese Forschung nicht nur im deutschsprachigen Raum zu betreiben, sondern mit einer englischen Publikation zu vertiefen. In meiner langjährigen akademischen Zeit wuchs zudem der Wunsch, einmal ein Buch bei Cambridge University Press zu veröffentlichen. Dies konnte ich nun während meines Forschungssemesters im Wintersemester 2023/24 verwirklichen.
Heike Probst: Worum geht es in Ihrem Buch?
Bernd Irlenborn: Sehr allgemein gesagt, geht es um das Verhältnis von Relativismus und Monotheismus. Es gibt verschiedene Versionen des Relativismus. Darunter versteht man zumeist, wiederum vereinfacht ausgedrückt, die Überzeugung, dass Wahrheitsansprüche nicht allgemein gültig sind, sondern eben, wie der Ausdruck sagt, nur relativ für bestimmte Gruppen, Personen oder unter bestimmten Bedingungen. Und diese Auffassung scheint in einem spannungsvollen Verhältnis zum Thema „Monotheismus“ zu stehen, denn der Monotheismus im traditionellen Sinne behauptet ja zum Beispiel, dass die Aussage „Es gibt einen dreieinen Gott“, eben nicht nur für Christen wahr ist, sondern für alle Menschen, auch wenn sie das nicht glauben. Und genau da scheint es eine interessante Spannung zu geben, der ich in meinem Buch nachgegangen bin.
Heike Probst: Und wie verhält sich diese Spannung?
Bernd Irlenborn: Grob gesagt, lassen sich zwei Positionen in der bisherigen Debatte zu diesem Thema nachzeichnen. Die eine Position sagt, dass der Relativismus eine tiefgreifende Gefahr für den Monotheismus sei. Kardinal Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., hat dazu in einer oft zitierten Bemerkung formuliert: „Einen klaren Glauben nach dem Credo der Kirche zu haben, wird oft als Fundamentalismus abgestempelt, wohingegen der Relativismus, das sich ‚vom Windstoß irgendeiner Lehrmeinung Hin-und-hertreiben-lassen‘, als die heutzutage einzige zeitgemäße Haltung erscheint. Es entsteht eine Diktatur des Relativismus, die nichts als endgültig anerkennt und als letztes Maß nur das eigene Ich und seine Gelüste gelten lässt.[1]“
Josef Ratzinger verwendete hier das umstrittene Schlagwort von der „Diktatur des Realismus“. Konträr dazu gibt es die Position, dass relativistisches Denken im Grunde kein Problem für den Monotheismus sei, sondern ein angemessener Ausdruck der Moderne und der heutigen Pluralität von Weltbildern. Für diese Position erscheint die Haltung von Papst Benedikt von der Tendenz her als neue Form des Antimodernismus. Für manche Vertreter der zweiten Position kann die katholische Kirche durchaus von den relativistischen Strömungen lernen und ihren eigenen Wahrheitsanspruch beschränken. Angewendet auf unser Beispiel, dass die Aussage „Es gibt einen dreieinen Gott“ nicht mehr für alle Menschen wahr sein müsste, sondern beispielsweise nur für diejenigen, die daran glauben. In meinem Buch versuche ich, einen Mittelweg zwischen diesen beiden Positionen einzuschlagen, indem ich für die Verhältnisbeziehung zwischen unterschiedlichen Typen von Relativismus unterscheide. Ich zeige, dass gewisse Typen von Wahrheitsrelativismus durchaus negativ für den Monotheismus im Allgemeinen und den christlichen Glauben im Besonderen sind. Allerdings finden sich auch andere Typen von Relativismus, der deskriptive Relativismus, die keine negativen Auswirkungen auf den Monotheismus haben müssen, sondern sogar helfen können, im Kontext des Pluralismus deutlich zu machen, dass der christliche Glaube eine religiöse Position darstellt unter vielen Weltdeutungen, für die deren Anhänger zumeist auch gute Gründe anführen können.
Heike Probst: Woran knüpfen Sie in der deutschen bzw. internationalen Forschung an?
Bernd Irlenborn: Also generell wird das Thema „Relativismus“ größtenteils eher im angelsächsischen Raum und in den USA erforscht, in Deutschland ist es weniger verbreitet. Von daher war es natürlich auch besonders reizvoll für mich, ein englisches Buch zu schreiben, um an diesen breiten Forschungsdiskurs anzuknüpfen. Speziell zum Thema meiner Publikation gibt es aber auch im angelsächsischen Raum noch kein Buch. In Deutschland ist die Diskussion um den Relativismus, ich nenne es einmal so, ‚kontaminiert‘ durch diese eher politischen Positionierungen und die zunehmenden theologischen Vorbehalte gegen das Denken Josef Ratzingers.
Heike Probst: Welche Rolle haben Ihre beiden Auslandsaufenthalte für dieses Buch gespielt?
Bernd Irlenborn: In Harvard oder im Jesus College in Oxford konnte ich mit einigen der dortigen Wissenschaftlern Ausschnitte dieses Projektes nochmal genauer analysieren. Es war eine sehr produktive Zeit für die Arbeit am Buch. In Harvard entdeckte ich zum Beispiel, dass es auch im Kontext des Hinduismus relativistische Strömungen gibt, also nicht nur im Monotheismus.
Heike Probst: Wie funktioniert eine Publikation bei Cambridge University Press?
Bernd Irlenborn: Mich hat die angelsächsische Forschungswelt immer schon fasziniert. Deswegen habe ich auch immer wieder in den letzten fünfzehn Jahren dort meine Forschungssemester verbracht. Und eine Publikation bei Cambridge University Press war schon immer mein akademischer Traum. Das hat damit zu tun, dass die Standards für die Publikationen bei einem solchen Verlag ganz anders sind als bei deutschen Verlagen. Ich benötigte erst einmal verschiedene Gutachten zum Projekt des Buches. Hier wird geprüft, ob das Thema überhaupt lohnenswert ist für den Verlag. Wenn das positiv entschieden ist, wird aber auch nicht garantiert, dass das Buch gedruckt wird. Am Ende der Schreibphase wird das fertige Manuskript dann nochmals begutachtet. Alle Gutachten – bei mir waren es vier – müssen positiv sein und für eine Publikation sprechen, damit es überhaupt publiziert wird. Cambridge University Press ist der älteste Wissenschaftsverlag der Welt und ich bin zufrieden, dass es letztlich geklappt hat.
Heike Probst: Die Publikationen in dieser Reihe sind in der Länge begrenzt, es wird quasi eine Essenz veröffentlicht. Die Kunst dieser Form liegt darin, mit wenig Raum auszukommen und die eigenen Gedanken konzentriert für die Leserinnen und Leserinnen darzustellen.
Bernd Irlenborn: Man darf sich von der Kürze des Buchs nicht in die Irre führen lassen. Für mich war das wirklich die schwierigste Publikation. Jeder Satz und jedes Wort sind bestimmt vier, fünf Mal gedreht und gewendet worden. Der Text ist – um ein Bild zu verwenden – wie ein Eisberg formuliert. Auf der Oberfläche, der sichtbaren Seite, muss der Text für religionsphilosophisch Interessierte, die sich mit dem Thema des Verhältnisses von Relativismus und Monotheismus beschäftigen, verständlich sein. Auf der anderen, nicht sichtbaren Seite muss der Text aber auch für Expertinnen und Experten im Bereich des Relativismus interessant sein. Diese können den auf der Oberfläche nur angedeuteten, ungeschriebenen Subtext entziffern, der hinter oder zwischen jedem Satz steht. Man sieht im Grunde genommen in der Formulierung nur die Spitze des Eisberges, aber die Expertin sieht sofort, dass jeder Satz (etwa zu den großen Themen „Wahrheit“ und „Realismus“) einen bestimmten Bereich zusammenfasst, der viel umfänglicher ist. Es war wirklich deutlich schwieriger, diese 70 Seiten zu schreiben als 300 Seiten in früheren Büchern. Ob das gelungen ist, wird die Kritik zeigen.
Heike Probst: Wird es ein Anschlussprojekt geben?
Bernd Irlenborn: Ich habe jetzt drei Buchpublikationen zum Thema „Relativismus“ veröffentlicht. Das erste Buch war eine rein philosophische Einführung, die ich 2016 im De Gruyter-Verlag publiziert habe, die sich nicht an Theologen gerichtet hat. Das zweite Buch, das ich mit dem Münsteraner Dogmatiker Michael Seewald herausgegeben habe, war eine Anthologie zum Verhältnis von Relativismus und christlichem Glauben aus verschiedenen theologischen Disziplinen. Und das dritte Buch ist nun eine allgemeine kurze präzise Sondierung zum Verhältnis Monotheismus zum Relativismus aus religionsphilosophisch-theologischer Perspektive geworden. Diese Forschung würde ich gern mit anderen Themen weiterführen. Interessant wäre es beispielsweise, der Fragestellung nach einem aktuellen tragfähigen Konzept von Mission nachzugehen, wie es sich unter den Bedingungen von Relativismus, Fundamentalismus und Postkolonialismus stellt.
Heike Probst: Herzlichen Dank für das Gespräch.
[1] Predigt von Joseph Ratzinger bei der „Missa Pro Eligendo Romano Pontifice“ am 18. April 2005 im Petersdom
Zum Forschungsprojekt Relativismus